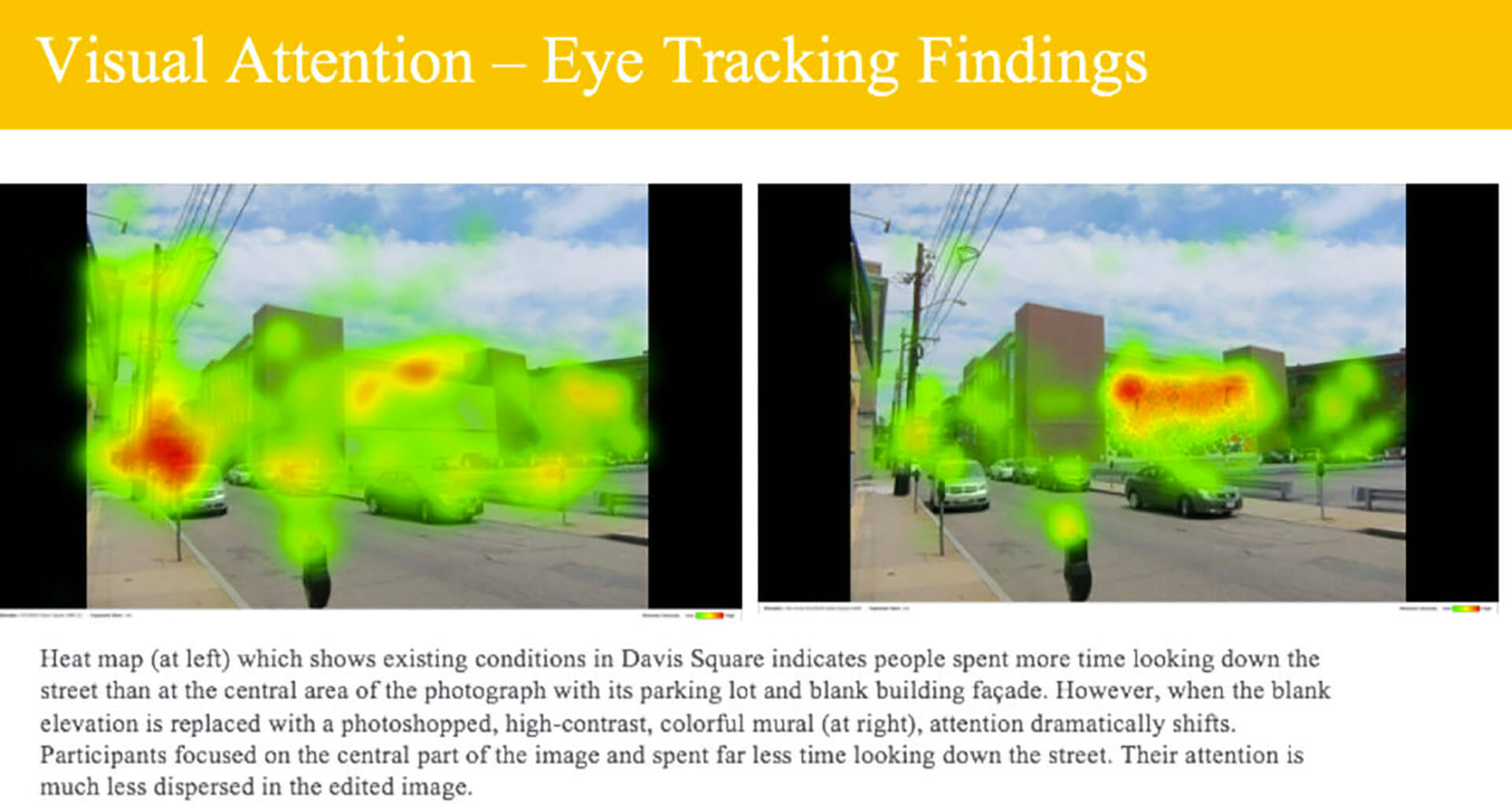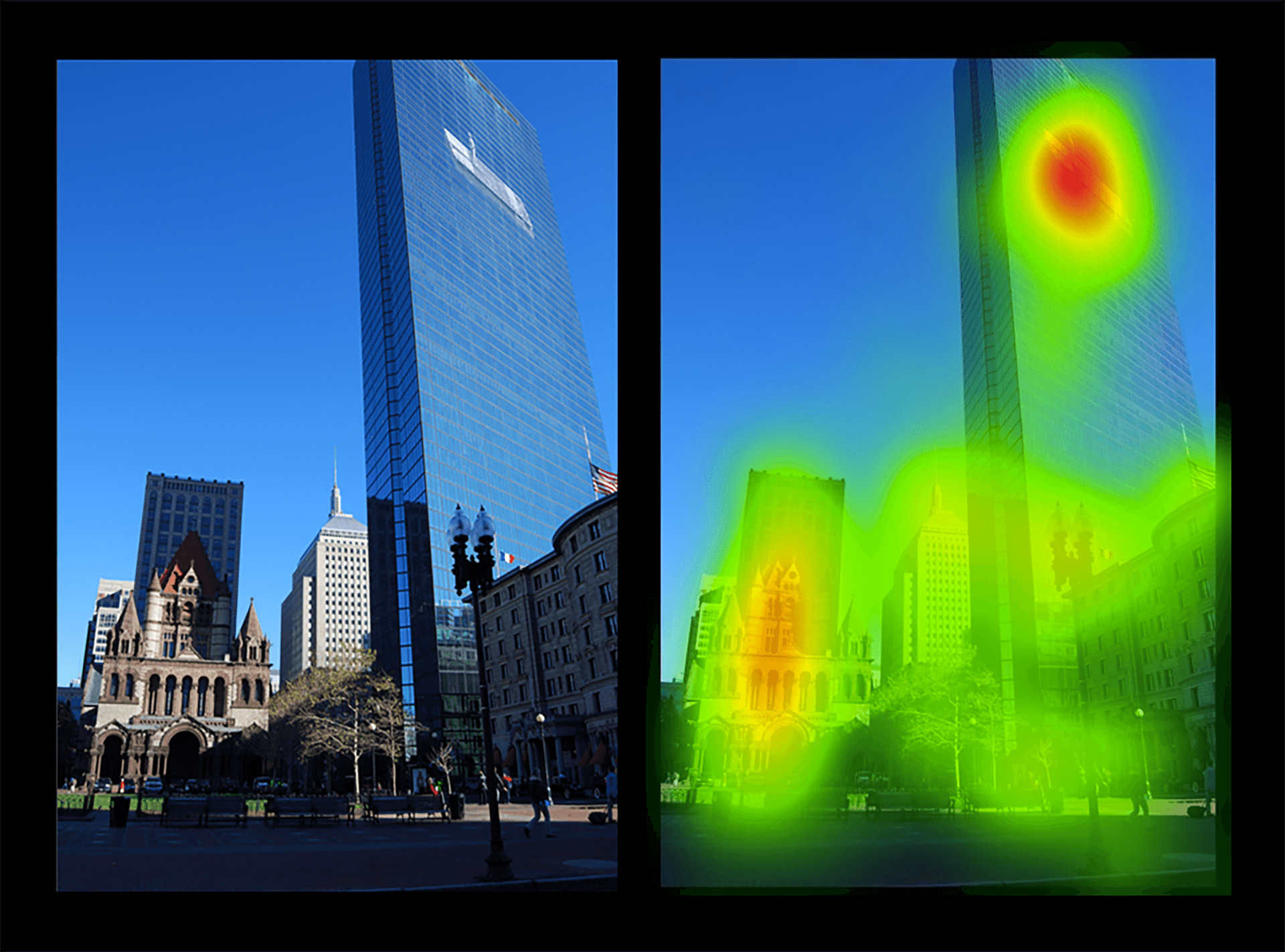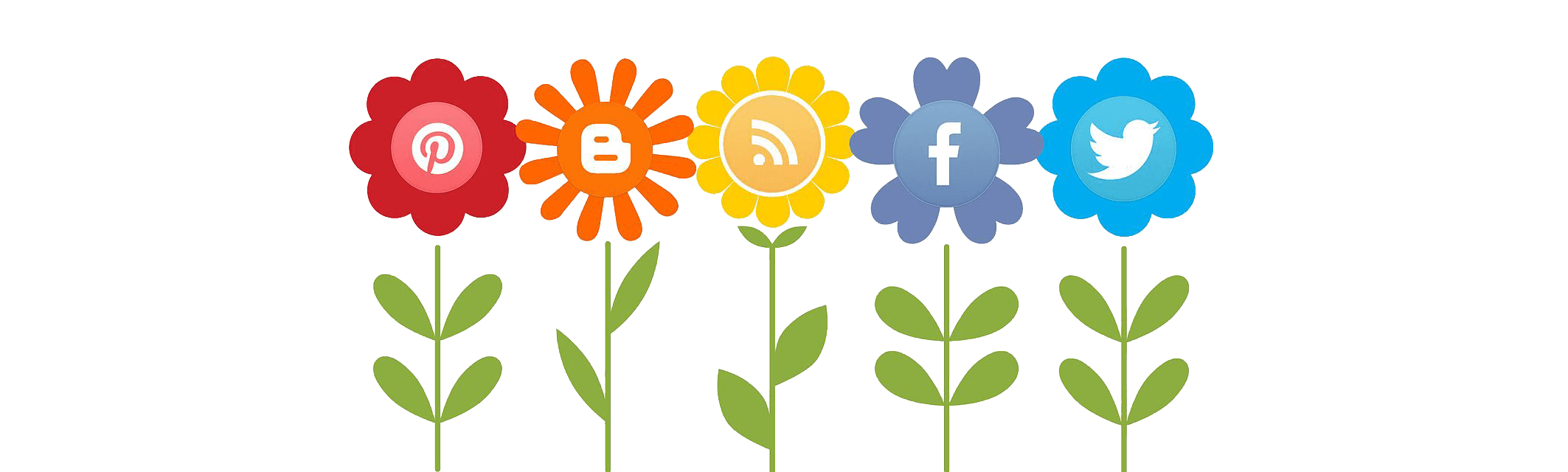Sportunterricht
Sportunterricht
Schlimmer als Mathe
Dein Spiegel & Ina Hunger
Die Sportwissenschaftlerin Ina Hunger erzählt im Gespräch mit „Dein Spiegel“, warum Mannschaftswahlen demütigend sein können – und wieso das Gefühl des Versagens bei einer Turnübung schlimmer ausfallen kann als beim Vorrechnen an der Tafel.

Sollte es mehr oder weniger Sportunterricht in der Schule geben?
Wichtiger als die Anzahl der Sportstunden ist die Qualität. Wenn man fünf Stunden die Woche schlechten Sportunterricht hat, schadet das eher. Wenn es aber gute Stunden sind, von denen alle Kinder etwas haben, dann wäre es sicherlich schön, wenn wir mehr davon hätten.
Wie sieht guter Sportunterricht aus?
Gut ist, wenn alle Kinder die Möglichkeit haben, etwas Neues im Sport kennenzulernen. Wenn alle Kinder erfahren, dass es toll ist, sich körperlich zu verausgaben oder Leistungen zu verbessern. Dass es spannend ist, wenn man zusammen etwas macht oder sich vergleicht. In einem guten Sportunterricht fühlen sich die Kinder wohl, und niemand hat Angst oder wird gemobbt.
Sie forschen zu psychischer Gesundheit im Sportunterricht. Was bedeutet das?
Ich untersuche, ob Kinder durch ihren Sportunterricht verunsichert oder sogar psychisch verletzt werden. Ob sie zum Beispiel Angst vor dem Unterricht entwickeln, ob sie sich in bestimmten Situationen schämen oder ausgegrenzt werden. Wenn Kinder im Sportunterricht immer wieder leiden, etwa weil sie sich den Anforderungen nicht gewachsen fühlen, häufig blöde Kommentare zu hören bekommen, über ihre sportliche Leistung oder über ihren Körper – dann ist das psychisch ungesund.
Welche Probleme gibt es in den Stunden?
Zum Beispiel werden Kinder durch veraltete Maßnahmen, wie »Mannschaftswahlen«, gedemütigt. Wenn man als Letztes vor den Augen der ganzen Klasse in eine Mannschaft »gewählt« wird, quält das die Betroffenen innerlich sehr lange. Dabei gibt es 1000 andere Möglichkeiten, eine Klasse aufzuteilen. Es kommt auch vor, dass Kinder vor der ganzen Klasse immer wieder eine Übung machen müssen, zu der sie überhaupt nicht in der Lage sind. Und es gibt Situationen, in denen eine ganze Klasse jemanden auslacht oder beschimpft. Meist trauen sich die Betroffenen dann auch nicht zu sagen: »Das ist gemein!« Und die anderen Kinder setzen sich nur selten für ein gemobbtes Kind ein.
In Mathe an der Tafel vorrechnen zu müssen, kann auch unangenehm sein. Warum kann der Sportunterricht besonders schlimm sein?
Sportlich zu sein und einen fitten Körper zu haben ist bei Kindern und Jugendlichen oft viel, viel wichtiger, als gute Noten in Mathe zu bekommen. Wenn ich in Mathe an der Tafel etwas nicht kann, kann ich mir immer noch sagen: Ich habe eben nicht geübt. Wenn ich aber im Sportunterricht versage, denke ich: Ich habe nicht den »richtigen« Körper, ich genüge nicht den Ansprüchen, die andere an mich haben. Das Gefühl des Versagens geht im Sport also viel tiefer.
Gibt es einen Unterschied zwischen Schulsport und dem Sport, den die Kinder nachmittags im Verein betreiben?
Ja! In den Verein geht man freiwillig. Man wählt eine Sportart aus, die man mag, trifft andere in ähnlichem Alter, die sich auch für die Sportart interessieren, und man kann jederzeit weggehen. Schulsport ist kein Hobby, sondern Pflicht. Er soll zur Allgemeinbildung beitragen. Er wird benotet, und man macht ihn innerhalb der Klasse, mit der man über Jahre auch in anderen Fächern zusammen lernt.
Wie könnte man den Unterricht besser gestalten?
Ein Sportunterricht, der Kinder dazu bringen soll, sich auch in der Freizeit zu bewegen, muss motivieren! Und allen Kindern deutlich machen, dass es sich lohnt und Spaß macht, Sport zu treiben. Dazu gehört, dass Lehrkräfte sensibel sind und Schulkinder solidarischer. Niemand wird gesünder oder selbstbewusster oder übt freiwillig Sport aus, wenn er oder sie in der Schule Sportstunden erlebt, die immer wieder belastend sind. Sportunterricht bietet einen wichtigen Zugang zu Bewegung, kann aber auch wahnsinnig viel kaputt machen.

Prof. Dr. Ina Hunger
Jahrgang 1965, ist Sportwissenschaftlerin an der Universität Bremen. Sie forscht zu psychischer Gesundheit im Sportunterricht, also dazu, wie die Erfahrungen im Unterricht sich auf die Gefühle der Schulkinder auswirken.
“Dein SPIEGEL”
Das Nachrichten-Magazin für Kinder, herausgegeben von „Der Spiegel“. „Dein Spiegel“ bietet verständlich geschriebene Geschichten aus aller Welt, Interviews und News aus Politik und Gesellschaft für Leserinnen und Leser ab 8 Jahren.
Mehr davon?
Und jetzt: Sie.
WOLLEN SIE IHR PROJEKT ODER IHR PRODUKT PUBLIZIEREN?